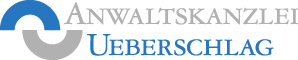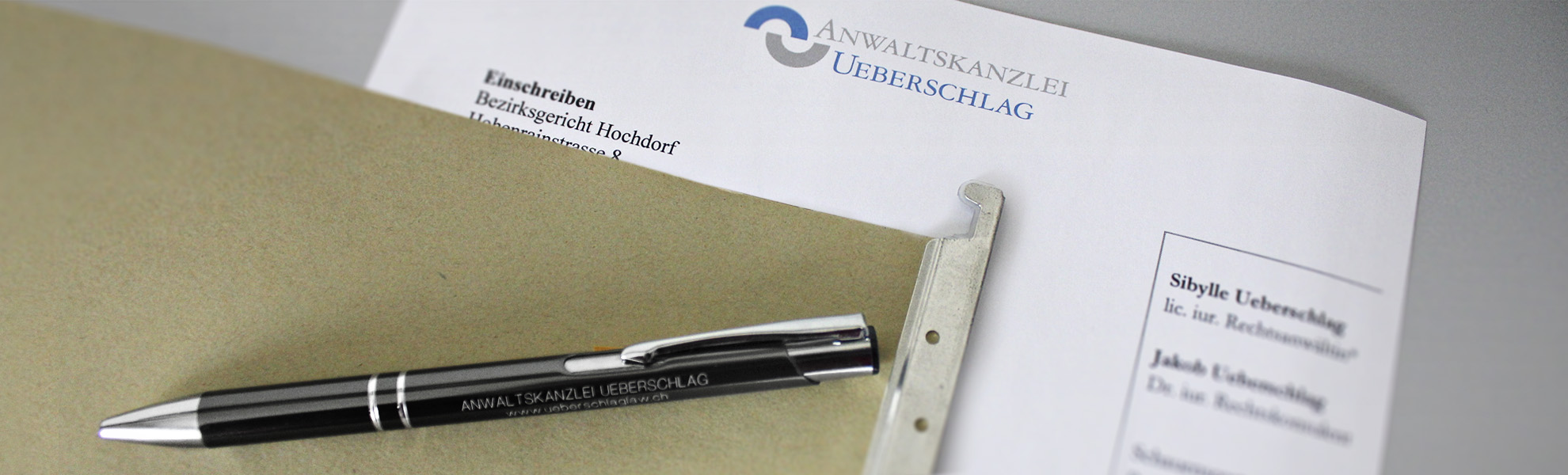Häufig gestellte Fragen
1. Wie muss man vorgehen, wenn man sich scheiden lassen möchte?
3. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn sich der Ehepartner nicht scheiden lassen möchte?
9. Wer darf in der ehelichen Wohnung/im Haus bleiben?
10. Was wird mit der Scheidung auch noch geregelt?
1. Wie muss man vorgehen, wenn man sich scheiden lassen möchte?
Grundsätzlich gibt es zwei Varianten, wie man sich scheiden lassen kann:
- Sofern beide Ehegatten mit der Scheidung einverstanden sind, kann man beim Gericht ein gemeinsames Scheidungsbegehren und – sofern man sich auch bezüglich der Scheidungsfolgen (wie Unterhalt, eheliche Wohnung, Güterrecht) einig ist – eine (Teil-)Vereinbarung über die Scheidungsfolgen einreichen (Art. 111 / 112 ZGB). Nach einer richterlichen Anhörung wird die Ehe – falls alle Voraussetzungen erfüllt sind – vom Gericht geschieden und die Scheidungsfolgen, über die man sich nicht einigen konnte, werden geregelt.
- Möchte sich nur ein Ehegatte scheiden lassen, kann er nach einer mind. zweijährigen Trennungszeit eine Scheidungsklage beim Gericht einreichen (Art. 114 ZGB). Die Ehe wird dann vom Gericht geschieden und die Scheidungsfolgen werden geregelt.
Getrenntleben (Art. 175 ff. ZGB) bedeutet, dass man den gemeinsamen Haushalt aufhebt, wobei die Wirkungen der Ehe fortdauern. Die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts muss nicht vom Gericht angeordnet werden, jedoch werden regelmässig – wenn sich die Ehegatten nicht einig sind – die Folgen des Getrenntlebens (wie Obhut und persönlicher Verkehr der unmündigen Kinder, Zuweisung der Wohnung, Kinderunterhalt, Ehegattenunterhalt) vom Gericht geregelt. Der trennungswillige Ehegatte hat drei Möglichkeiten:
- Aussergerichtliche Vereinbarung: Sind sich beide Ehegatten bezüglich des Trennungswillens und der Trennungsfolgen einig, so müssen sie nicht das Gericht anrufen. Sind jedoch gemeinsame minderjährige Kinder vorhanden oder wurden Ehegattenunterhaltsbeiträge vereinbart, so müssen die diesbezüglichen Regelungen vom Gericht genehmigt werden.
- Eheschutzgesuch: Besteht der Trennungswille nur bei einem der Ehegatten bzw. können sich die Ehegatten nicht über die Trennungsfolgen einigen, so kann jeder Ehegatte beim Gericht ein sog. Eheschutzgesuch (auch Trennungsbegehren) einreichen. Nach einer gerichtlichen Anhörung wird der gemeinsame Haushalt aufgehoben und die Trennungsfolgen werden geregelt.
- Trennungsvereinbarung: Sind sich die Ehegatten bezüglich der Trennung und deren Folgen einig, so können sie gemeinsam eine Trennungsvereinbarung beim Gericht einreichen. So regeln sie die Folgen der Trennung unter sich und diese Regelung kann vom Gericht bestätigt werden.
Vorlagen für das gemeinsame Scheidungsbegehren, die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, Scheidungsklage, Trennungsbegehren sowie Trennungsvereinbarung: https://gerichte.lu.ch/rechtsgebiete/formulare.
2. Ist es möglich, sich – ohne Einverständnis des Ehegattens – schon vor der zweijährigen Trennungszeit scheiden zu lassen?
Vor Ablauf der zweijährigen Trennungszeit kann ein Ehegatte nur ausnahmsweise die Scheidung verlangen, und zwar wenn ihm die Fortsetzung der Ehe aus schwerwiegenden Gründen, die ihm nicht zuzurechnen sind, nicht zugemutet werden kann (Art. 115 ZGB). Das Gericht geht bei der Auslegung der «schwerwiegenden Gründen» sehr restriktiv vor (z.B. bei schwerer körperlicher und seelischer Misshandlung oder bei einseitiger Scheinehe).
Für die Regelung der Verhältnisse während der Trennung, kann beim Gericht ein Trennungsgesuch oder – falls man sich über die Folgen der Trennung einig ist – eine Trennungsvereinbarung eingereicht werden (vgl. Ausführungen zu Frage 1).
3. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn sich der Ehepartner nicht scheiden lassen möchte?
Falls die Fortführung der Ehe nicht im Sinne von Art. 115 ZGB unzumutbar ist (vgl. Ausführungen zu Frage 2), bleibt nur die Möglichkeit, die zweijährige Trennungsfrist abzuwarten und danach eine Scheidungsklage einzureichen. Für die Regelung der Verhältnisse während der Trennung, kann beim Gericht ein Trennungsgesuch oder – falls man sich über die Folgen der Trennung einig ist – eine Trennungsvereinbarung eingereicht werden (vgl. Ausführungen zu Frage 1).
4. Bei welchem Gericht muss das Scheidungsbegehren inkl. (Teil-)Vereinbarung bzw. die Scheidungsklage eingereicht werden?
Das Scheidungsbegehren inkl. (Teil-)Vereinbarung bzw. die Scheidungsklage ist für Ehegatten, die in der Schweiz leben, beim Zivilgericht am Wohnsitz einer der beiden Ehegatten einzureichen (Art. 23 Abs. 1 ZPO).
Falls ein Ehegatte Wohnsitz im Ausland hat, kommt das internationale Privatrecht unter Berücksichtigung internationaler Staatsverträge zur Anwendung.
5. Wie wird die «elterliche Sorge», «Obhut» sowie der «persönlicher Verkehr» bzw. der «Betreuungsanteil» der gemeinsamen unmündigen Kindern im Scheidungsverfahren geregelt?
Die Regelung kann wie folgt aussehen (vgl. Art. 133 ZGB):
- Elterliche Sorge: In der Regel behalten die Eltern auch nach der Scheidung die gemeinsame elterliche Sorge (Art. 298 Abs. 2 ZGB). Dies bedeutet, dass die Eltern gemeinsam über den Aufenthaltsort und die Erziehung der Kinder sowie über die Verwaltung des Kindervermögens entscheiden und dass sie beide die gesetzliche Vertretung der Kinder ausüben. Das Gericht kann jedoch ausnahmsweise einem Ehegatten die alleinige elterliche Sorge übertragen, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls notwendig ist (z.B. bei Abwesenheit oder Gewalttätigkeit eines Elternteils; vgl. Art. 298 Abs. 1 ZGB).
- Obhut (Art. 298 Abs. 2 ZGB): Die Obhut umfasst das Recht bzw. die Befugnis, mit dem Kind zusammenzuleben und für seine tägliche Betreuung und Erziehung zu sorgen. Bei alleiniger elterlicher Sorge hat der sorgeberechtigte Elternteil automatisch auch die Obhut. Bei gemeinsamer elterlicher Sorge kann das Gericht entweder einem Ehegatten die alleinige Obhut zuteilen oder eine sog. alternierende Obhut beider Ehegatten (z.B. von Montag bis Donnerstag beim einen und von Freitag bis Sonntag beim anderen Elternteil) anordnen. An oberster Stelle stehen dabei jedoch nicht die Wünsche der Eltern, sondern das Kindeswohl. Entscheidend sind die Beziehung der Kinder zu den beiden Elternteilen, die Erziehungsfähigkeiten der Eltern und die Bereitschaft der Eltern, sich persönlich um die Kinder zu kümmern. Die Regelung der Obhut soll zu stabilen Beziehungen und damit zu einer optimalen Entwicklung der Kinder führen.
- Persönlicher Verkehr (Art. 298 Abs. 2 ZGB): Bei alleiniger elterlicher Sorge oder bei gemeinsamer elterlicher Sorge, aber alleiniger Obhut eines Ehegatten, haben der nicht sorge-/obhutsberechtigte Ehegatte sowie die Kinder ein gegenseitiges Besuchs- und Ferienrecht. So kann festgelegt werden, wie oft (und wann) der nicht sorge-/obhutsberechtigte Ehegatte die Kinder besuchen oder sie zu sich auf Besuch / in die Ferien nehmen darf. Dabei gilt die Regelung nach Art. 273 ff. ZGB.
- Betreuungsanteile (Art. 298 Abs. 2 ZGB): Bei gemeinsamer elterlicher Sorge und alternierender Obhut spricht man vom Betreuungsanteil, der geregelt werden muss. Dabei gilt die Regelung des persönlichen Verkehrs nach Art. 273 ff. ZGB analog.
6. Muss ich Unterhalt für meine unmündigen Kinder bezahlen bzw. erhalte ich Unterhalt für meine unmündigen Kinder?
Eltern sind auch nach der Scheidung weiterhin verpflichtet, für den Unterhalt ihrer Kinder aufzukommen; zumindest bis zu ihrer Volljährigkeit bzw. bis zur abgeschlossenen Erstausbildung (Art. 276 ff. ZGB). Der nicht sorge-/obhutsberechtigte Ehegatte schuldet dem unmündigen Kind in der Regel Unterhalt in Form einer Geldzahlung an den sorge-/obhutsberechtigten Ehegatten, jedoch nur soweit beim zahlungspflichtigen Ehegatten nicht ins betreibungsrechtliche Existenzminimum eingegriffen wird (d.h. nur, wenn der zahlungspflichtige Ehegatte sein Leben trotz der Unterhaltsbeiträge selbst noch finanzieren kann). Man unterscheidet zwischen Barbedarf und Betreuungsunterhalt:
- Barbedarf: Dabei handelt es sich um Bedarfspositionen jedes Kindes wie z.B. Grundbetrag (für Nahrung und Kleider), Wohnkostenanteil, Krankenkassenprämien, Schulkosten, Fremdbetreuungskosten. Ist der unterhaltspflichtige Elternteil zur Finanzierung des Barunterhalts der Kinder nicht in der Lage, so wird für jedes Kind das sog. Manko festgesetzt. Verbessern sich die finanziellen Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich (z.B. durch Lottogewinn oder Erbschaft), können die nicht gedeckten Unterhaltsbeiträge der letzten fünf Jahre im Nachhinein eingefordert werden.
- Betreuungsunterhalt: Der Betreuungsunterhalt soll die Betreuung des Kindes durch Eltern oder Dritte gewährleisten. Er umfasst die Lebenshaltungskosten (wie Grundbetrag, Wohnkosten, Hausrat-/Haftpflichtversicherung, Krankenkassenprämien, berufsbedingte Kosten etc.) des betreuenden Elternteils. Da der betreuende Elternteil aufgrund der Kinderbetreuung keiner oder nur einer begrenzten Erwerbstätigkeit nachgehen kann, muss der unterhaltspflichtige Ehegatte auch für die Kosten des betreuenden Elternteils aufkommen, soweit diese nicht gedeckt sind.
7. Muss ich Unterhalt für meinen Ehegatten/meine Ehegattin bezahlen bzw. habe ich Anspruch auf einen solchen?
Ist es einem Ehegatten nicht zuzumuten, für seinen Unterhalt selbst aufzukommen (d.h. kann kein oder zu wenig Einkommen erzielen), so muss der andere Ehegatte einen angemessenen Beitrag (sog. nachehelicher Unterhalt) leisten. Dabei werden die Gesamtumstände wie Aufgabenteilung und Lebensstellung während der Ehe, Dauer der Ehe, Alter/Gesundheit der Ehegatten und Einkommen/Vermögen als Massstab genommen (Art. 125 ZGB). Nachehelicher Unterhalt ist jedoch nur dann geschuldet, wenn dadurch nicht in das betreibungsrechtliche Existenzminimum des Unterhaltspflichtigen eingegriffen wird.
- Bei lebensprägender Ehe (wie Ehedauer über 10 Jahren und/oder gemeinsame Kinder; Entwurzelung aus dem bisherigen Kulturkreis) wird auf den zuletzt in der Ehe gelebten Lebensstandard abgestellt, d.h. beide Ehegatten sollen nach der Scheidung möglichst in gleichen Verhältnissen weiterleben dürfen wie während der Ehe. Ist eine Arbeitsaufnahme des unterhaltsberechtigten Ehegatten nicht zumutbar, ist der Unterhalt unter Umständen sogar bis zur Pensionierung geschuldet. Durch den nachehelichen Unterhalt soll der sog. ehebedingte Nachteil ausgeglichen werden. Wenn z.B. der Ehemann sich um Kinder und Haushalt gekümmert hat und dadurch eine Erwerbs- und damit eine Karriereeinbusse hinnehmen musste, soll die Ehefrau, welche ihre Karriere während der Ehe fördern konnte, den Ehemann nach der Ehe unterstützen (nacheheliche Solidarität).
- War die Ehe nicht lebensprägend (kurze Ehedauer [unter 5 Jahren], keine Kinder), ist selten ein Unterhaltsbeitrag geschuldet, da meist beide Ehegatten während der Ehe weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind und damit keinen ehebedingten Nachteil erlitten haben.
8. Ich war während der Ehe für den Haushalt (und die Kinder) zuständig und ging keiner Erwerbstätigkeit nach bzw. nur in einem kleinen Pensum. Muss ich nach der Scheidung wieder bzw. mehr arbeiten?
Grundsätzlich gilt, dass jeder Ehegatte einer Erwerbstätigkeit nachgehen muss, sofern dies zumutbar ist. Geht ein Ehegatte keiner Erwerbstätigkeit nach, obwohl dies zumutbar wäre, wird ihm bei der Unterhaltsberechnung ein hypothetisches Einkommen (das bei einer Erwerbstätigkeit erzielt werden könnte) angerechnet.
- Für den hauptbetreuenden Elternteil minderjähriger Kinder gelten im Kanton Luzern folgende Grundsätze für dessen Erwerbstätigkeit:
- unter Umständen bereits ab Eintritt des jüngsten Kindes in den Kindergarten: Erwerbspensum von 20-30% zumutbar,
- ab Eintritt des jüngsten Kindes in die Primarschule: Erwerbspensum von 40-50% zumutbar,
- ab Eintritt des jüngsten Kindes in die Oberstufe: Erwerbspensum von 70-80% zumutbar,
- wenn das jüngste Kind 16 Jahre alt ist: Erwerbspensum von 100% zumutbar.
- Eine vollständige Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit nach der Scheidung bzw. Trennung wird bei einem Alter zwischen 45 und 50 Jahren (Zeitpunkt der definitiven Trennung massgebend) als nicht mehr realistisch und damit unzumutbar erachtet. Eine Erhöhung des Arbeitspensums (falls der Ehegatte auch während der Ehe in einem Teilzeitpensum gearbeitet hat) kann jedoch auch in diesem Alter verlangt werden. Sind zum Zeitpunkt der Trennung minderjährige Kinder zu betreuen, so ist für die Zumutbarkeit des beruflichen Wiedereinstiegs auf den Zeitpunkt des Wegfalls der Betreuungspflichten abzustellen.
- Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen, welche vor der Scheidung aufgetreten sind, kann unter Umständen eine Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit unzumutbar sein.
9. Wer darf in der ehelichen Wohnung/im Haus bleiben?
In der Regel geht der Scheidung eine Zeit des Getrenntlebens voraus und es besteht daher bereits eine vorläufige Zuteilung der ehelichen Wohnung/des Hauses. Entscheidend für die definitive Zuweisung der Wohnung/des Hauses ist das praktische Bedürfnis der Ehegatten, d.h. wem die Wohnung/das Haus mehr nützt oder wem der Auszug leichter fällt (Art. 121 ZGB). Hingegen selten von Belang ist die Frage, wer Mieter der Liegenschaft ist. Berücksichtigt wird insbesondere, wer mit den unmündigen Kindern zusammenlebt, da die Kinder nicht gezwungen werden sollen, ihr vertrautes Umfeld zu verlassen. Ausserdem stellt sich die Frage, ob ein Ehegatte beruflich auf die Wohnung/das Haus angewiesen oder persönlich eng mit der Wohnung/dem Haus verbunden ist (z.B. bei tiefer Verwurzelung oder bei einer aufgrund der Invalidität eines Ehegatten umgebauten Wohnung).
Steht die Liegenschaft allerdings im Alleineigentum eines Ehegatten, kann das Gericht an den Eigentumsverhältnissen nichts ändern. Eine gerichtliche Übertragung des Eigentums auf den anderen Ehegatten ist ausgeschlossen. Das Gericht kann jedoch dem Ehegatten, der nicht Eigentümer der Liegenschaft ist, jedoch darin verbleiben möchte, unter den gleichen Voraussetzungen und gegen angemessene Entschädigung oder unter Anrechnung auf Unterhaltsbeiträge ein befristetes Wohnrecht einräumen (Art. 121 Abs. 3 ZGB).
10. Was wird mit der Scheidung auch noch geregelt?
Mit der Scheidung werden auch die Scheidungsfolgen geregelt. Dazu gehören – neben elterlicher Sorge/Obhut/persönlicher Verkehr/Betreuungsanteile, Unterhalt und ehelicher Wohnung/Haus – insbesondere die güterrechtliche Auseinandersetzung (Aufteilung des Vermögens) sowie der Vorsorgeausgleich (berufliche Vorsorge [BVG]).
- Güterrechtliche Auseinandersetzung: Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gelten die Bestimmungen nach Art. 181 ff. ZGB. Haben die Ehegatten keinen Ehevertrag abgeschlossen und nach dem 01. Januar 1988 geheiratet, so gilt der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 197 ff. ZGB). Dies bedeutet für die Scheidung kurz zusammengefasst, dass jeder Ehegatte sein sog. Eigengut (persönliche Gegenstände, Erbschaften, Schenkungen, Ersparnisse von vor der Ehe) behält und die sog. Errungenschaft (v.a. Erwerbseinkommen während der Ehe, Dividenden, Zinsen) eines jeden Ehegatten hälftig geteilt wird.
- Vorsorgeausgleich (Art. 122 ff. ZGB): Hatten die Ehegatten während der Ehe eine klassische Aufgabenteilung (ein Ehegatte ist erwerbstätig, der andere kümmert sich um Haushalt und Kinder), bzw. war ein Ehegatte voll erwerbstätig und der andere bloss teilzeitlich, so konnte sich der (voll) erwerbstätige Ehegatte während der Ehe eine wesentlich bessere berufliche Vorsorge aufbauen als der nicht (voll) erwerbstätige Ehegatte. Im Rahmen der Scheidung wird deshalb in der Regel die während der Ehe angesparte Austrittsleistung beider Ehegatten hälftig geteilt.